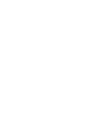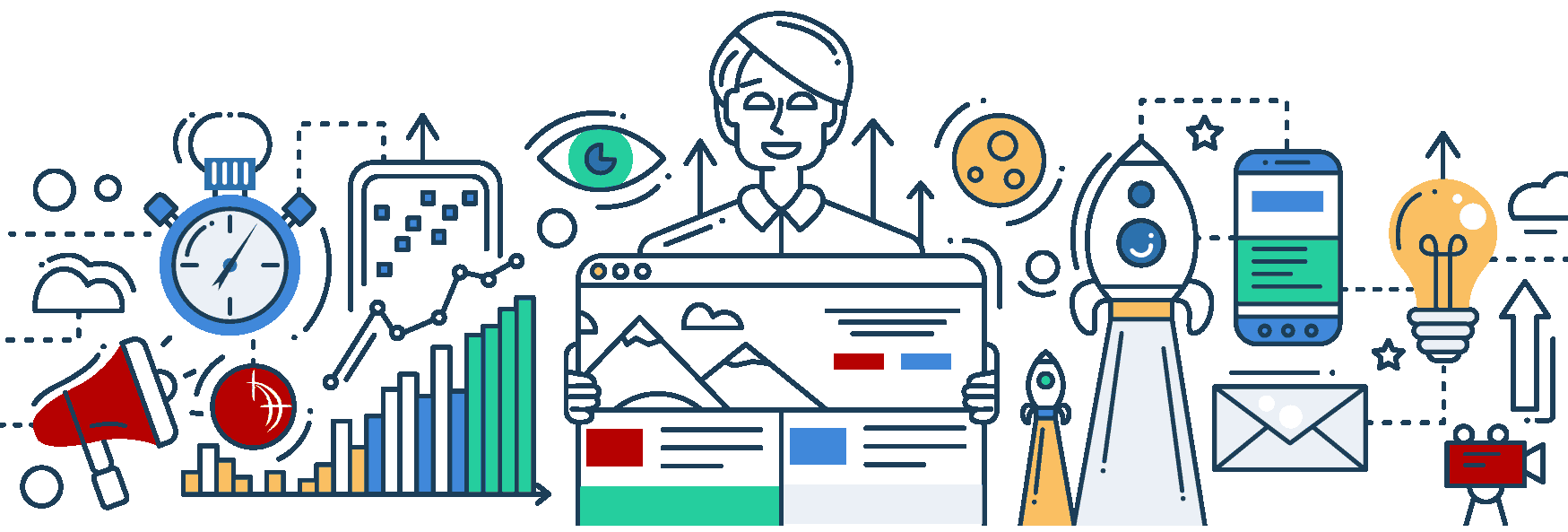„Französisch ist die schönste Sprache – nach Schwäbisch!“
Annegret und Albrecht Hengerer waren über 35 Jahre mit der Liebenzeller Mission im Einsatz, zunächst ab 1989 in der Gemeindegründung in der Normandie/Frankreich und ab Sommer 2017 in Burundi. Sie unterstützten die dortige Gemeinde durch Predigten und Schulungen sowie durch administrative und seelsorgerliche Begleitung. Vor seiner Ausbildung am Theologischen Seminar der Liebenzeller Mission war Albrecht Diplom-Verwaltungswirt (FH). Annegret ist gelernte Krankenschwester. Jetzt gehen sie in den Ruhestand und blicken auf ihre Arbeit zurück.
Albrecht, wie bist du Missionar geworden?
Albrecht Hengerer: Ich bin mit 15 Jahren zum Glauben gekommen. Das hat mein Leben so verändert, dass ich einfach davon erzählen musste, in der Jugendgruppe und dann auch in der Gemeinde. Zunächst war es mir wichtig, zu Hause in Hessigheim bei Ludwigsburg, wo ich aufgewachsen bin, Missionar zu sein. Mein Vater war Landwirt und Weingärtner und hat zu mir gesagt: „Kerl, du musst was Richtiges lernen.“ Und so wurde ich Diplom-Verwaltungswirt. Aber irgendwann hat mir Gott deutlich gesagt, dass ich jetzt in die Welt gehen soll, um von ihm zu erzählen: „Mach eine Ausbildung, damit du fähig dazu wirst.“ So kam ich nach Bad Liebenzell ins damalige Theologische Seminar. Von der Liebenzeller Mission war ich zunächst für Japan vorgesehen, um dort als Verwaltungsleiter zu arbeiten. Aber Gott wollte es anders. So kam ich 1989 nach Frankreich in die Normandie nach Avranches. Auch dort habe ich nebenbei viel Verwaltungsarbeit erledigt. Aber meine Hauptaufgabe war es, Gemeinden zu gründen. Das habe ich 25 Jahre lang gemacht. Wir haben praktisch bei null angefangen und erst eine kleine Hauskreisgemeinde und dann eine Gemeinde aufgebaut.
Ihr seid dann nach Burundi gewechselt. Was ist für dich der Hauptunterschied zwischen der Missionsarbeit in Frankreich und in Afrika?
Albrecht Hengerer: In Frankreich galt es als Tabu, über den Glauben zu sprechen. Das war nur mit Freunden oder Bekannten möglich und zu bestimmten Gelegenheiten, in Notlagen, wenn es in der Familie Krankheit oder Tod gab. Oder wenn die Sorgen zu groß wurden, baten die Franzosen manchmal um ein Gebet, und so kamen wir immer wieder ins Gespräch. In Burundi braucht man dagegen nur drei Minuten, um mit jemandem über den Glauben zu reden. Da wird man sofort gefragt, wo man zum Beten hingeht. In Burundi gehört der Glaube fast zur Kultur. Dort muss man die Christen schulen, dass der Glaube tiefer geht. In Frankreich dagegen ist die Entscheidung für den christlichen Glauben eine tiefgreifende Sache.
Annegret, wie hast du die kulturellen Unterschiede zwischen Frankreich und Burundi erlebt?
Annegret Hengerer: Eigentlich war Frankreich eine gute Vorbereitung für Burundi. Zum Beispiel ist die Wohlfühldistanz in Frankreich schon geringer als in Deutschland und Küsschen als Begrüßung werden ganz normal. Diese Nähe hat uns geholfen, auf die Burundier zuzugehen. Trotzdem gab es in Burundi neue Herausforderungen, in Bezug auf was „Frau“ tut oder nicht tut. Ich fand es schade, dass Pfeifen ein absolutes Tabu war. Auch meine Rolle als Ehefrau musste sich anpassen. Gut fand ich den Rat, solche Erfahrungen als „anders“ wahrzunehmen und nicht als gut oder schlecht einzuordnen.
Frankreich gilt als schwieriges Missionsland.
Albrecht Hengerer: Ja, das sehe ich auch im Vergleich zu Afrika. Der Kontinent gilt für viele als klassisches Missionsgebiet, das merken wir auch am Spendenaufkommen. Dabei ist der Missionsbedarf in Frankreich viel höher, weil es dort weniger Christen gibt. Es gibt zwar formal viele Katholiken, aber viele wollen von Kirche und Glauben nichts wissen. Das Wissen um den christlichen Glauben nimmt enorm ab, dagegen bezeichnen sich in Burundi schätzungsweise 90 Prozent der Menschen als Christen und es ist selbstverständlich, über seinen Glauben zu sprechen. In Frankreich kostet die Missionsarbeit viel mehr Überwindung.
Wie kam es zum Wechsel nach Burundi? Weil dort auch Französisch gesprochen wird?
Albrecht Hengerer: Wir hatten beide von Gott den Eindruck bekommen, dass wir unsere Aufgabe – ich war damals Leiter des Missionsteams und der Gemeinde – wechseln sollten. In diese Überlegung hinein kam die Anfrage der Liebenzeller Mission, ob ich als französisch sprechender Verwaltungsfachmann unsere anglikanische Partnerkirche in Burundi unterstützen könnte, gerade als „älterer Jahrgang“. Ich war damals 56 Jahre alt und sollte zunächst nur für ein Jahr nach Afrika gehen, weil man nicht wusste, wie wir das als Europäer schaffen würden. Daraus sind dann aber fast acht Jahre geworden.
Annegret Hengerer: In Burundi engagierten wir uns in der regionalen und nationalen Ehe- und Frauenarbeit. Außerdem hatte ich die Möglichkeit, Deutschunterricht für Studenten zu geben, was sehr viel Freude gemacht, aber auch sehr viel Kraft gekostet hat.
Was waren die Höhepunkte eurer Missionsarbeit?
Albrecht Hengerer: Jede Gemeindegründung – wo vorher nichts war und dann eine Gemeinde entstanden ist – war für uns ein Höhepunkt. Der größte Höhepunkt war 2010 die Mitgründung der Evangelischen Allianz in Frankreich. Dort haben sich 2.400 Gemeinden zusammengeschlossen: Pfingstler, Charismatiker und Evangelikale wie wir. Und das ist ein wunderbarer Segen geworden. Viele Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen evangelikalen Strömungen sind dadurch beendet worden und haben zur Zusammenarbeit geführt. Und es war natürlich ein absoluter Höhepunkt, wenn Menschen mit oft stark atheistischem Hintergrund zu einem lebendigen Glauben gefunden haben. Es war bewegend zu sehen, wie diese dann zu starken Stützen in den neuen Gemeinden wurden. Das war für mich so das Größte.
Wie hat sich aus deiner Sicht die Missionsarbeit in den letzten 35 Jahren verändert?
Albrecht Hengerer: Als wir in Frankreich anfingen, gab es zunächst keinen richtigen Plan: „Gründet einfach Gemeinden in Gegenden, wo es noch keine gibt.“ Und dann hat man mich und meine Frau einfach in der Stadt abgesetzt und gesagt: „So, schaut euch das alles einmal an und macht was.“ Das war meine Arbeitsbeschreibung, ganz kurz und knackig. Heute denkt man darüber nach, ein Team von Missionaren mit unterschiedlichen Begabungen zu bilden und auszusenden. Aber viele Teams scheitern, weil es an Abstimmung und einer klaren Vision fehlt, was sie erreichen wollen. Aber ich schätze sowohl die Teamarbeit als auch die Tatsache, dass ich oft allein gearbeitet habe. Wir haben uns für Teamarbeit auf Distanz entschieden. Das bedeutete, dass etwa alle 40 Kilometer ein Missionarsehepaar stationiert war. So konnten wir innerhalb einer Stunde beim anderen sein und ihm bei bestimmten Veranstaltungen helfen. Wir haben auch gemeinsam Gemeinden gegründet. Zuerst waren alle in der ersten Gemeinde, dann sind einige weggezogen, haben die zweite Gemeinde gegründet und sind dann wieder weggezogen, um die dritte Gemeinde zu gründen. Diese Teamarbeit auf Distanz hat sehr gut funktioniert, weil jeder auch ein Stück weit Gemeinden nach seinen Vorstellungen gründen konnte. Am Ende sind es die gleichen Gemeinden geworden, interessanterweise mit den gleichen Schwierigkeiten und Stärken.
Wie sehen nun eure Pläne für den Ruhestand aus?
Albrecht Hengerer (lacht): Ich habe schon drei Angebote. Aber wir wollen wie bisher darauf hören, was Gott mit uns vorhat, damit wir das richtige Angebot finden, das zu uns passt und wo wir wirklichen nützlich sein können. Das Engagement wird altersbedingt bedächtiger sein, aber dafür können wir unsere Erfahrungen einbringen. Fest steht bisher nur, dass ich am 1. Juni offiziell in den Ruhestand gehe. Und so wie es jetzt aussieht, werde ich noch ein halbes Jahr ehrenamtlich für die Liebenzeller Mission tätig sein, um sie bei verschiedenen Veranstaltungen zu vertreten.
Annegret, und was hast du dir für deinen Ruhestand vorgenommen?
Annegret Hengerer: Ich möchte erst einmal nicht mehr als Frau eines Pastors wahrgenommen werden. Ich möchte einfach mehr Freiraum haben, um Dinge zu tun, die mir Freude machen. Da bin ich gerade dabei, mich zu sortieren. Das geht vom Stricken übers Klöppeln bis zum Reiten und Gleitschirmfliegen.
Was würdet ihr jungen Menschen raten, die Missionar werden wollen?
Annegret Hengerer: Als wir jung waren, dachten wir, als Christ müsse man sich immer zurücknehmen. Ich habe dann aber die Erfahrung gemacht, dass Gott gerade in den Dingen geholfen hat, die ich einfach angefangen habe und die mir Freude gemacht haben.
Muss man für die Missionsarbeit sprachbegabt sein?
Albrecht Hengerer: Nein, überhaupt nicht! In Sprachen war ich eine totale Niete. Wegen Französisch bin ich sogar sitzengeblieben. Beim Abitur habe ich zu Gott gebetet: „Bitte nie wieder Französisch in meinem Leben!“ Er hat mir dann zehn Jahre Zeit gelassen – und dann bin ich in die Sprachschule gegangen und finde heute, dass Französisch die schönste Sprache der Welt ist – nach Schwäbisch. Und mit Afrika war es ähnlich. Ich hab zu Annegret gesagt, wir lassen uns überall hinschicken, nur nicht nach Afrika – und heute sind wir so begeistert von Afrika. Also Gott macht es gut. Er rüstet dich aus, auch wenn ich das Wort blöd finde. Aber ich habe das einfach immer wieder gemerkt, gerade, als ich Teamleiter war. Plötzlich hatte ich die Fähigkeiten, Teamleiter zu sein. Natürlich habe ich mich weitergebildet, aber meine Grundeinstellung hatte sich geändert. Als ich dann mehr als Berater in Afrika tätig war und mehr mit Menschen sehr intim über ihren Glauben gesprochen habe, hat Gott mir das geschenkt. Natürlich kann man sich weiterbilden, aber Gott weiß letztlich, was ich kann. Und er benutzt mich dann so, wie er mich braucht. Und er benutzt mich auf diese Weise. Ich mache zum Beispiel gerne Witze, auch in der Predigt. Und die Menschen haben das sehr genossen. Also Gott benutzt jede Fähigkeit, um es richtig zu machen. Und als ich zur Liebenzeller Mission kam, dachte ich, der Missionsberg ist der Berg der Heiligen, da passe ich nicht hin. Aber Gott hat mir dann gezeigt, dass ich da nicht reinpassen muss, sondern dass er einen Plan für mein Leben hat und mich so gebrauchen will, wie ich bin. Und ich glaube, das hat er jetzt mein ganzes Leben lang getan. Und dadurch konnte ich Frucht bringen, dadurch sind Menschen zum Glauben gekommen und durch meine Art, die Gott mir gegeben hat, gewachsen. Ich bin sehr froh, dass zum Beispiel in Avranches in der Normandie jetzt jemand an meine Stelle getreten ist, der eine ganz andere Art hat. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die Gemeinde ihn so angenommen hat und jetzt mit ihm weiterwächst.
Wie hat sich deiner Erfahrung nach das Bild von Mission verändert?
Albrecht Hengerer: Wir sind jetzt seit 42 Jahren in der Mission. Als wir anfingen, hieß es bei uns im Dorf: „Der will nur nicht arbeiten, der wird Missionar.“ Dann kam der große Vorwurf, Missionare sind Kulturzerstörer. Und als dann die Fernsehserien anfingen mit Menschen, die ins Ausland gehen, um sich dort eine neue Existenz aufzubauen, wurden wir bewundert. Und als wir in den letzten Jahren in Deutschland zu Besuch waren, kamen junge Menschen auf uns zu und sagten: „Ihr seid ein echtes Vorbild für uns, weil ihr schon so lange in der Mission seid. Wir gehen jetzt auch.“ Es hat also ein Wandel stattgefunden, was den Blick auf die Mission angeht. Die Arbeit und die Methoden ändern sich, aber meine Botschaft ist dieselbe geblieben. Gott hat mich langsam verändert, aber ich bin immer authentisch geblieben. Es ist nur die Gesellschaft, die die Dinge anders interpretiert. Und jetzt, kurz vor dem Ruhestand, werden wir irgendwie geschätzt als Missionare. Das ist mir fremd, weil ich eigentlich als Mensch geschätzt werden möchte und nicht wegen meines Berufes.
Annegret Hengerer: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott mich manchmal in Aufgaben hineingestellt hat, die eigentlich zu groß für mich waren, dass er mir dann aber auch die Gabe und die Fähigkeit gegeben hat, dem gerecht zu werden. Zum Beispiel habe ich einmal drei Jahre lang die Tontechnik bei einer Konferenz am Mischpult betreut, was ich eigentlich gar nicht kann.
Albrecht Hengerer: Sie hat das besser gemacht als ich, der das sonst immer gemacht hat.
Annegret Hengerer: Wichtig ist, dass wir einfach offen bleiben für unsere persönliche Beziehung zu Gott. Dass Gott in uns wirken kann, dass er meinen Charakter verändern kann. Und dann kann ich strahlen, dann kann ich Licht und Salz sein. Und ja, da musste ich manches lernen in meinem Leben und lerne immer noch.